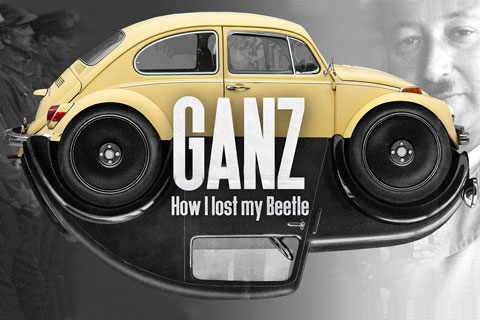Etwas Fahrkultur bitte!

Was ist das überhaupt? Bei Autotests wurde früher damit die Geschmeidigkeit der Fahrt, die Laufruhe des Motors oder der Komfort des Innenraums beschrieben. Ein kultivierter Wagen war ein tendenziell luxuriöser Wagen. Ich verstehe darunter allerdings auch noch etwas anderes.
An der Kultur misst sich die menschliche Entwicklung. Ja, das Vorhandensein von Spuren nicht direkt zweckorientierten Handelns belegt in der Anthropologie, ob eine Form menschlichen Lebens bereits existiert hat oder nicht. Kultur ist ein Indikator für menschliches Verhalten, ich bin so frei und schliesse daraus: Fahrkultur demnach ebenso.
Aber richtig, ich wollte erklären, was ich unter Fahrkultur verstehe: Es ist die Art und Weise, zu «verkehren», wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt, mit welchem Transportmittel und wie.
Ich kann mich beispielsweise an einen Paris-Besuch als Kind erinnern, ich meine sogar an das erste Mal, als ich in der französischen Hauptstadt war. Ich erinnere mich an einen tendenziell sehr schnellen, reichlich chaotischen Verkehrsfluss auf den Champs Elysées, da wurde ordentlich Gas gegeben und in der logischen Folge – gebremst. Die Autos, egal welcher Preisklasse, hatten samt und sonders irgendeine Beule und am Steuer selbst übelst abgeranzter und vom Rost angeknabberter Fourgonettes und dergleichen sassen fein kravattierte Businessmen oder Geschäftsfrauen von oder auf dem Weg zur Arbeit.
Das alles war irgendwie anders, der Fluss des Verkehrs, die Wahrnehmung der Menschen drumherum, deren Umgang mit diesem immerwährenden Strom. Es hätte aber auch Zürich sein können, wie das Titelbild aus dem Fundus der ETH-Bibliothek e-pics vom Bellevue um 1973 zeigt, oder Luzern – genausogut wie irgend eine andere Stadt. Denn ich gebe es zu: Autos zuzuschauen, das hat mich noch nie gelangweilt. In Paris waren es allerdings nicht die Typen oder einzelnen Modelle, die micht faszinierten, ich kannte fast alles, was da herumfuhr, es war – wie erwähnt – die Art und Weise wie diese fuhren und die Menschen, die dies taten. Das ganze hatte einen Hauch von geheimnisvoller Exotik.

Peugeot 405 Mi16 in einer Strasse von Paris
Doch Paris war tatsächlich ein Ort von ganz besonderem Charakter, denn die wirklich interessanten Autos, so schien es, die tauchten regelmässig erst zum Einbruch der Nacht im Strassenbild auf, die guten Modelle eben, der Peugot mit 16-Ventil-Motor beispielsweise – statt jener mit Beule und Saugdiesel. Oder dann waren die Autos gleich so richtig gehörig anders: Meine erste Live-Begegnung mit einem Ferrari F40 hatte ich im Quartier Latin. Einen Facel-Vega – noch bevor ich die Marke überhaupt kannte – sah in Paris auf der Strasse an mir vorbeifahren. Es war, im Nachgang aufgrund des Erinnerungsvermögens recherchiert, vermutlich eine Facellia.
Aber auch in meiner Heimatstadt gab es Beispiele, die ich heute unter das Prädikat Fahrkultur stellen würde. So begegnete mir das erste Porsche 911 Cabriolet regelmässig beim Warten auf den Bus. Der Fahrer, stets unter freiem Himmel unterwegs und mit Hawaihemd gekleidet, drehte seine Runden zwischen dem Bahnhof und Löwenplatz, jeweils mit der Überquerung der Seebrücke dazwischen. Heute wäre das ein Poser, damals dachte ich, wir würden darum zur Welt mit dazugehören, da auch bei uns tolle Autos unterwegs waren.

Die Luzerner Seebrücke in den späten 1980er-Jahren, ideal zum Carspotten © ETH e-pics
Doch auch andere Dinge zähle ich zu Fahrkultur. Das sind beispielsweise jene Menschen, die ihren Wagen über Jahrzehnte behalten und pflegen, Menschen wie Leute aus meiner Strasse, die ihren alten Neunelfer seit Ewigkeiten als Alltagsauto nutzen. Sie könnten wohl auch "modern", am Geld fehlte es ganz bestimmt nicht, aber man pflegt eben diese verbrauchsorientierte Lebensweise nicht, sondern hegt das, wofür man einst die Verantwortung übernommen hat. Genau so wirkt dies auf mich: Die Dinge werden nicht einfach käuflich erworben, sondern man fühlt, dass sie einem anvertraut wurden – ein Wechselspiel. Die Besitzer haben einst durch glückliche Umstände oder harte Arbeit – oder beides gleichzeitig – zu ihrem Auto gefunden und pflegen es nun wie ein Familienmitglied. Es zu wechseln kommt einem Verrat gleich.

Ob der neue Wagen zu gross für die einst für das alte Auto extra hinzugebaute und bemessene Garage geworden ist? © ETH e-pics
Und es gibt Menschen, die haben einst die Garagenzufahrt ihres Hauses nach den Massen ihres Wagens bauen lassen, da gibt man diesen nicht einfach weg. Gut, vielleicht ist das nicht Kultur, aber mit scheint es ein sehr kultiviertes Handeln, wenn nicht nur der Fokus auf dem Objekt selbst liegt, sondern sein Beziehungsgeflecht drumherum auch eine Rolle spielt.

Unsynchronisiert und trickreich: Schalten im Graham-Paige von 1929
Auch die sich freiwillig auferlegte Mühsal und die Wahl des schwierigeren, anstrengenderen Weges empfinde ich als eine höhere Kulturstufe als der ständige Weg des geringsten Widerstands. Klar sind Servolenkung oder Synchrongetriebe toll, ganz zu schweigen von einer Klimaanlage. Doch das Hantieren mit reiner Muskelkraft und das Sich-selbst-beweisen von Bedienkompetenz hat etwas Befriedigendes.
Und nein, Fahrkultur findet man nicht nur bei grossen, kostspieligen Luxuswagen oder Sportwagen. Bei meiner Werkstatt schaut immer wieder mal ein älterer Herr vorbei mit einem VW Polo C der zweiten Serie. Für Aussenstehende ist das kaum mehr als ein alter Polo Steilheck in einer sandbeigen Farbe und mit einer sehr kargen Ausstattung. Doch dessen Besitzer hat dem – seinem! – Auto bereits eine Vollrestaurierung angedeihen lassen. Und neulich musste er zugeben, dass er das Auto nach einem Rempler nochmals habe neu lackieren müssen – mit Kosten weit jenseits des Zeitwerts. Für mich ist es Fahrkultur, wenn jemand zu seinem Auto steht, satt immer von neuem den Wagen zu wechseln.