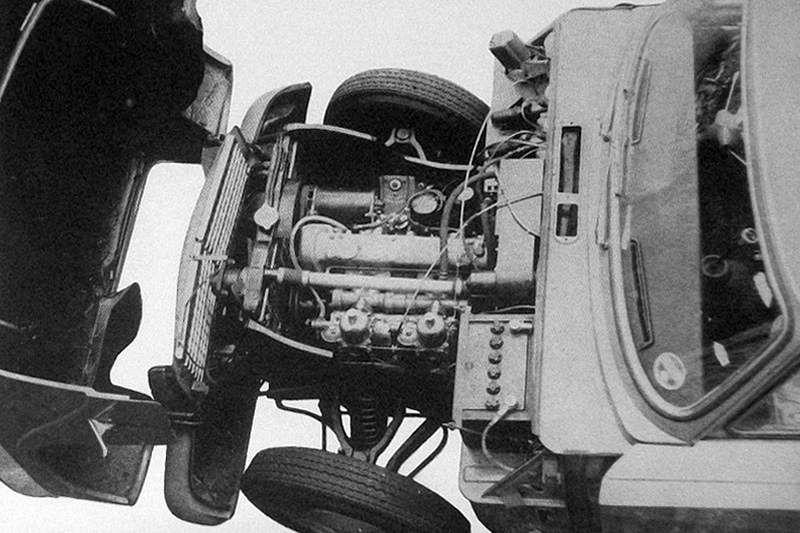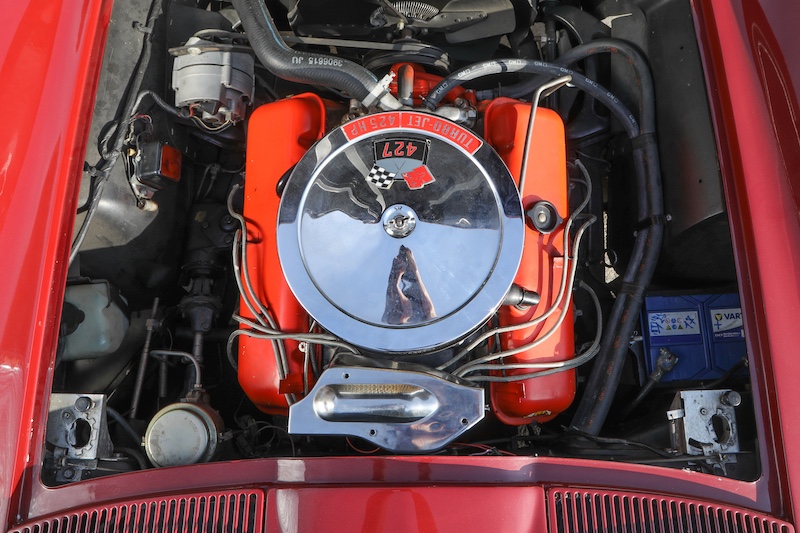Es muss weiterhin Ausnahmen für Oldtimer geben

In den letzten Tagen kam es vielen Leuten zu Ohren, dass die EU darüber nachdenkt, eine jährliche Pflichtinspektion für ältere Autos zu fordern. Dies wird im Rahmen der Revision der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und der Richtlinie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen diskutiert.
Offenbar erhofft man sich mit häufigeren Kontrollen mehr Sicherheit (und weniger Verkehrstote) auf den Strassen. Zudem verspricht man sich auch einen geringeren Schadstoffausstoss, wenn die Autos häufiger überwacht werden.
Während man sich bei Autos, die täglich im Einsatz sind uns jährlich zehn- oder gar zwanzigtausend Kilometer abspulen, noch vorstellen kann, dass eine häufigere Kontrolle etwas bewirken kann, sind solche Gedanken beim Klassiker eher müssig. Nicht nur behandeln Oldtimer- und Youngtimerbesitzer ihre Wagen gut, sie warten sie auch mit viel Akribie, schliesslich sollen sie Autos (und Motorräder) noch viele Jahrzehnte erleben.
In Deutschland muss heute ein Oldtimer alle zwei Jahre zum TÜV, in der Schweiz profitieren historische Fahrzeuge (mit Veteranenausweis) sogar von einer sechsjährigen Pause zwischen zwei Besuchen der Motorfahrzeugkontrolle. Dass sich dies in höheren Unfallzahlen oder schlechterer Abgasqualität geäussert hätte, lässt sich kaum beobachten oder gar nachweisen.
Als Veteranenfahrzeuge klassierte Klassiker dürften in der Schweiz denn auch nur maximal 3000 km pro Jahr fahren, legen also in sechs Jahren maximal 18'000 km zurück. Die Realität zeigt, dass die Fahrstrecken noch deutlich tiefer liegen im Schnitt, nämlich bei 700 km pro Jahr gemäss der letzten Umfrage des SHVF.
Die heutigen Regelungen haben sich bewährt, davon abzuweichen macht zumindest für die klassischen Automobile wenig Sinn. Eine jährliche Kontrolle hätte gerade für diese Autos und ihre Besitzer klar negative Auswirkungen, ohne dafür anderswo wirklich Nutzen zu stiften. Hoffen wir also, dass der finale Legislativvorschlag der EU, der noch im Jahr 2025 erwartet wird, keine negativen Überraschungen birgt.