Lamborghini Jarama 400 GTS – Liebe auf den zweiten Blick
Artikel verschenken
Jetzt abonnieren und Artikel verschenken
Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.
PDF nicht verfügbar
Technischer Fehler
Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.
PDF drucken
«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Zu Merkliste hinzufügen
Login
Premium-Abo kaufen
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Der Einsteigertarif
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!
Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.




































































































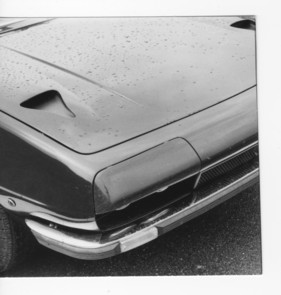























Sie haben nur
8 von 66
Bilder in hoher Auflösung gesehen
Information
Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.
Zusammenfassung
Von 1970 bis 1976/78 baute Lamborghini den Jarama als 400 GT und 400 GTS. Das Frontmotorcoupé war ein Granturismo reinster Schule, ein Sportwagen, den man sogar zum Brötchen besorgen aus der Garage holen konnte. Nur gerade 327 Exemplare wurden gebaut, entsprechend selten sind sie zu sehen und wenn sie vorbeifahren, fallen sie vielen Passenten wegen des zurückhaltenden Stylings noch nicht einmal auf. Dieser Fahrbericht erzählt die Geschichte des Jarama und portraitiert ein Exemplar aus dem Jahr 1976 auf vielen Bildern. Natürlich fehlen auch das Tonmuster und historisches Bildmaterial nicht.
Dieser Artikel enthält folgende Kapitel
- Tiefstapler
- Kurzer Radstand, lange Überhänge
- Juwel unter der Motorhaube
- Sportlicher Fahrwerksbau
- Nicht fertig entwickelt?
- Vom GT zum GTS
- Selbstversuch
- Unterbewertet?
- Weitere Informationen
Geschätzte Lesedauer: 8min
Leseprobe (Beginn des Artikels)
Etwas enttäuscht waren wir schon! Da fuhren wir in einem der teuersten und heissblütigsten Sportwagen der Siebzigerjahre durch dicht-besiedeltes und gut bevölkertes Gebiet und trotzdem schien kaum jemandem der blaue Lamborghini Jarama 400 GTS aufzufallen. Mit einem Miura oder Countach hätte sich dies sicherlich komplett anders verhalten, dabei teilte doch der Jarama nicht nur die Motorkonstruktion und die Philosophie hinter vielen Bauelementen mit den damaligen Supersportwagen aus Sant’Agata, sondern auch den Zeichenstift des Designers Marcello Gandini . Manfred Jantke brachte es in seinem Test für die Zeitschrift Auto Motor und Sport auf den Punkt. Er beschrieb das Design des Jarama als unterkühlt und wenig aufregend. Das sei genau das Richtige für 30 Prozent der Lamborghini-Kundschaft, die die Kraft und Technik des Sportwagens lieber ohne Publikum geniessen würden, meinte Jantke optimistisch.
Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?
Premium-Artikel freischalten
Bilder zu diesem Artikel

Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Das Anmelden dauert wenige Sekunden.
Empfohlene Artikel / Verweise
Markenseiten
Mehr lesen zum Thema
Blogs & Kommentare
Aus dem Zeitschriftenarchiv
Aktuelle Fahrzeug-Inserate
Aktuelle Marktpreise (Auswahl)
Spezialisten (Auswahl)
Spezialist
Neustadt, Deutschland
+4963213995704
Spezialisiert auf Alfa Romeo, Ferrari, ...
Spezialist
Neustadt, Deutschland
+49 6327 97700
Spezialisiert auf Maserati, Ferrari, ...
Spezialist
Bern, Schweiz
+41 31 326 27 90
Spezialisiert auf Aston Martin, Alfa Romeo, ...
Spezialist
Aarberg, Schweiz
+41 79 369 04 32
Spezialisiert auf Ferrari, BMW, ...
Spezialist
Zürich, Schweiz
+41 78 715 00 50
Spezialisiert auf Chevrolet, Pontiac, ...
Spezialist
Muhen, Schweiz
+41 79 332 81 91
Spezialisiert auf AC, Adler, ...










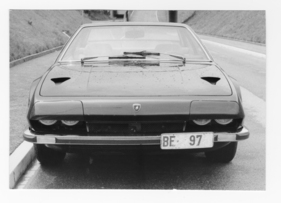


































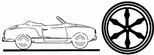
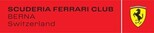

Kommentare