VW Golf LS – so grün wie die Hoffnung
Artikel verschenken
Jetzt abonnieren und Artikel verschenken
Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.
PDF nicht verfügbar
Technischer Fehler
Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.
PDF drucken
«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Zu Merkliste hinzufügen
Login
Premium-Abo kaufen
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Der Einsteigertarif
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!
Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.









































































































































Sie haben nur
1 von 71
Bilder in hoher Auflösung gesehen
Information
Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.
Zusammenfassung
Der VW Golf war für die Marke aus Wolfsburg das wichtigste neue Modell seit der Nachkriegszeit, ohne ihn würde die Volkswagenwelt heute wohl ganz anders aussehen. Grund genug ganz zu den Anfängen zurückzukehren und die Qualitäten eines frühen Golf LS zu geniessen. Dieser Fahrerbericht erzählt die Geschichte des Erfolgsmodells und zeigt den frühen Golf auf vielen neuen und historischen Bildern. Auch ein Tonmuster und Verkaufsliteratur fehlen nicht.
Dieser Artikel enthält folgende Kapitel
- Präsentation im Mai 1974
- Fast ohne Konkurrenz
- Modern
- Aufpreispolitik
- Der Konkurrenz noch nicht ganz gewachsen
- Gemischte Erfahrungen
- Schneller und wieder langsamer
- Zuhause
Geschätzte Lesedauer: 10min
Leseprobe (Beginn des Artikels)
Grün ist die Hoffnung, und grün lackiert ist auch der Golf. Und was für ein Grün, es heisst Lofotengrün und die Farbe wirkt durch die orange-braune Innenausstattung noch kultiger. Viel mehr Siebzigerjahre-Stil ist fast nicht mehr denkbar. Gross war die Hoffnung, die Volkswagen mit dem VW Golf verknüpfte. Alle bisherigen Bemühungen, einen Nachfolger für den Verkaufshit Käfer zu lancieren, waren im Sande verlaufen. Der erste Volkswagen mit wassergekühlten Frontmotor war der Golf allerdings nicht und auch nicht der erste Volkswagen mit quer eingebautem Vierzylinder, der K70 und der Scirocco hatten diese modernen Konzeptionen bereits genutzt.
Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?
Premium-Artikel freischalten
Bilder zu diesem Artikel

Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Das Anmelden dauert wenige Sekunden.
Multimedia
Empfohlene Artikel / Verweise
Markenseiten
Mehr lesen zum Thema
Blogs & Kommentare
Aus dem Zeitschriftenarchiv
Aktuelle Fahrzeug-Inserate
Aktuelle Marktpreise (Auswahl)
Spezialisten (Auswahl)
Spezialist
Sirnach, Schweiz
+41 71 969 47 69
Spezialisiert auf Audi, BMW, ...




Spezialist
Ismaning, Deutschland
+498996055191
Spezialisiert auf Mercedes Benz, Ford (USA), ...
Spezialist
St. Margrethen, Schweiz
+41 (0)71 450 01 11
Spezialisiert auf Mercedes Benz, VW, ...




Spezialist
Inwil, Schweiz
+41 41 448 20 69 Sprechstunden Di-Fr 11-12 und 13.30-15.30
Spezialisiert auf Audi, VW




Spezialist
Birr, Schweiz
+41 56 444 90 11
Spezialisiert auf VW, Porsche
Spezialist
Bern, Schweiz
+41 31 326 27 90
Spezialisiert auf Aston Martin, Alfa Romeo, ...
Spezialist
Schinznach-Bad, Schweiz
+41 56 463 92 92
Spezialisiert auf Porsche, VW, ...
Spezialist
Amsterdam, Niederlande
Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...




















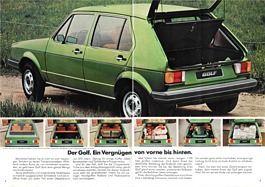
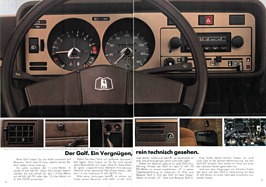


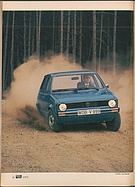
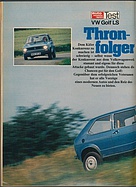


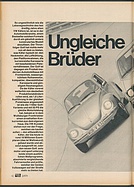





































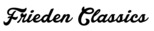












Kommentare