Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition – man gönnt sich ja sonst nichts
Artikel verschenken
Jetzt abonnieren und Artikel verschenken
Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.
PDF nicht verfügbar
Technischer Fehler
Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.
PDF drucken
«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Zu Merkliste hinzufügen
Login
Premium-Abo kaufen
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Der Einsteigertarif
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!
Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.



























































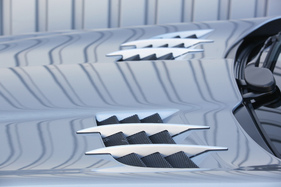








































































































Sie haben nur
5 von 85
Bilder in hoher Auflösung gesehen
Information
Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.
Zusammenfassung
Als Mercedes-Benz 1999 am Autosalon von Detroit die SLR Vision präsentierte, sorgte der kompromisslos gestylte Sportwagen mit fast unendlich langer Motorhaube für viel Aufmerksamkeit. Gerade von Mercedes hatte man einen solchen Wagen nicht erwartet. Doch Motorsport-Erfolge und die Zusammenarbeit mit McLaren machten eine Serienproduktion des SLR in Coupé- und Roadsterform möglich, wenn der Wagen auch nur für wenige erschwinglich war. Dieser Fahrzeugbericht erzählt die Geschichte des in sehr geringen Stückzahlen gefertigten SLR und zeigt ein Coupé der 722 Edition auf vielen Bildern.
Dieser Artikel enthält folgende Kapitel
- Mit der Tradition verwurzelt
- Startschuss zur Serie
- Auslieferungen ab 2004
- Der richtige Kompromiss?
- Ziemlich teure Sache
- Noch exklusiver: 722
- Geschlossen oder offen
- Und noch etwas weniger für mehr
- Fast 20 Jahre später
- Weitere Informationen
Geschätzte Lesedauer: 11min
Leseprobe (Beginn des Artikels)
Ab 1995 fuhr McLaren mit Mercedes-Benz-Motoren, 1998 und 1999 gewann Mika Häkkinen im McLaren-Mercedes die F1-Weltmeisterschaft und 1998 durfte Mercedes-Benz auch als Nummer 1 in der FIA-GT-Meisterschaft bei den Sportwagen abschliessen. Soviel Rennsporterfolg musste gefeiert werden, zumal Mercedes-Benz ja auch auf eine reichhaltige Rennhistorie aufzuweisen hat. Was lag näher, als mit McLaren zusammen einen Supersportwagen im Stile des 300 SLR der Fünfzigerjahre zu bauen? Während also bei Volkswagen schrittweise der Bugatti Veyron mit Mittelmotor entstand, zeichneten die Designer unter Bruno Sacco und Nachfolger Peter Pfeiffer einen klassischen Sportwagen mit unendlich langer Motorhaube, Formel-1-Nase und einem V8-Motor hinter der Vorderachse. Pfeiffer liess sich dazu zitieren: “Wir wollten an unsere große Vergangenheit anknüpfen, ohne in das Retro-Design zu gehen; wenn wir ein neues Auto bringen, muss es auch ein Blick in die Zukunft sein - und das ist im Rennsport die Formel 1”. Dem Design und diesen Vorgaben folgend, war der Frontmittelmotor bereits gesetzt.
Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?
Premium-Artikel freischalten
Bilder zu diesem Artikel

Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Das Anmelden dauert wenige Sekunden.
Empfohlene Artikel / Verweise
Mehr lesen zum Thema
Versteigerte Fahrzeuge
- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (2007), Verkauft
- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (2007), Verkauft
- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition (2007), Verkauft
- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition Coupé (2007), Verkauft
- Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition Coupé (2007), Verkauft
- Weitere suchen...
Ähnliche Technische Daten
- 1990: Mercedes-Benz 190 - 2-Liter - 105 PS (ECE) 1 Registervergaser
- 1970: Mercedes-Benz 280 SE 3.5
- 1990: Mercedes-Benz 300 CE-24 - 3-L-6-Zyl. 24 V - 220 PS (ECE) Benzineinspritzung
- 1992: Mercedes-Benz 300 CE-24 Cabriolet 300 CE-24 - 220 PS (ECE) Benzineinspritzung
- 1990: Mercedes-Benz 300 GD / Puch 300 GD - 3-L-6-Zyl. Diesel - 113 PS (ECE) Einspritzpumpe
Aus dem Zeitschriftenarchiv
Aktuelle Fahrzeug-Inserate
Aktuelle Marktpreise (Auswahl)
Spezialisten (Auswahl)
Spezialist
Sirnach, Schweiz
+41 71 969 47 69
Spezialisiert auf Audi, BMW, ...




Spezialist
Ismaning, Deutschland
+498996055191
Spezialisiert auf Mercedes Benz, Ford (USA), ...
Spezialist
Zug, Schweiz
+41 (0) 43 813 56 56
Spezialisiert auf Rolls-Royce, Bentley, ...




Spezialist
St. Margrethen, Schweiz
+41 (0)71 450 01 11
Spezialisiert auf Mercedes Benz, VW, ...




Spezialist
Amsterdam, Niederlande
Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...




Spezialist
Au, Schweiz
+41 71 280 22 22
Spezialisiert auf Volvo, Saab, ...
Spezialist
Muhen, Schweiz
+41 79 332 81 91
Spezialisiert auf AC, Adler, ...




Spezialist
Eberdingen-Hochdorf, Deutschland
+49 7042 270990
Spezialisiert auf Mercedes-Benz, Porsche, ...




Spezialist
Bern, Schweiz
+41 31 326 27 90
Spezialisiert auf Aston Martin, Alfa Romeo, ...
Spezialist
Safenwil, Schweiz
+41 62 788 79 20
Spezialisiert auf Jaguar, Toyota, ...




Spezialist
Wendelstein, Deutschland
+49 912926244
Spezialisiert auf Porsche, BMW, ...
Spezialist
Noord-Brabant, Niederlande
0031 416 751 393
Spezialisiert auf MG, Triumph, ...








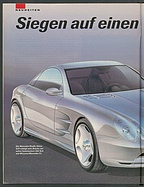

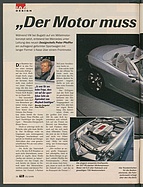


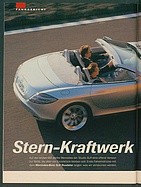







_RM.jpg)




































Kommentare