Gemässigter Barock – Ford 17M P2 im (historischen) Test
Zusammenfassung
1960 befand sich der Ford Taunus 17M schon in seinem vierten Produktionsjahr. Mit seinen Kurven, Flossen und auch der weichen Federung zitierte der grosse Kölner amerikanische Vorbilder, unter dem Blech fand sich aber bewährte europäische Technik. Schwächen leistete sich der “Barocktaunus” kaum, wenngleich Vorder- und Hinterachse ganz getreu seinem Kosenahmen nicht perfekt harmonierten. Dieser Fahrzeugartikel gibt einen Original-Testbericht von 1960 wieder und zeigt den Ford 17M P2 auf umfangreichem historischen Bild- und Verkaufsmaterial.
Dieser Artikel enthält folgende Kapitel
- Konstruktives
- Auf der Straße
- Aus der weiblichen Perspektive
- Technische Daten und Testergebnisse
Geschätzte Lesedauer: 13min
Leseprobe (Beginn des Artikels)
Dieser Bericht beginnt mit einem Geburtstagsglückwunsch: Der 17M trat nämlich vor genau drei Jahren, im August 1957, als jüngster Sproß des deutschen Ford-Werkes vor die kritische Öffentlichkeit. Er wurde kritisiert und er wurde gepriesen, die Fachleute maßen ihn an den Leistungen der Konkurrenz und das Publikum hielt mit seinem Urteil nicht zurück: es kaufte ihn. Der 17M ist ein Erfolgsauto wie sein kleinerer Bruder. Ein Bruder zwar, aber doch ein Wesen aus einer anderen Epoche. Das Wachstum des 12M läßt sich über die Etappen „Junior“, „Köln“, „Eifel“ und „Taunus“ genau verfolgen. Er ist das typische Evolutionsauto, das in seinen Anfängen noch die Pferdekutsche als Ahnherren nicht ganz verleugnen konnte. Der 17M ist als „Auto“ geboren und repräsentiert in vielen seiner technischen Details die Gedankenwelt einer neuen Zeit. Das sieht man ihm schon äußerlich an. Mit seinen die Horizontale betonenden Linien, dem frech geschrägten Vertikalverlauf der Front und dem flachen Dachauslauf wohnt selbst dem stehenden 17M schon eine gewisse Dynamik inne. Das Fahrverhalten enttäuscht denn auch nicht: zwar ist auch dieser Ford kein „schnelles“ Auto im üblichen Sinn, aber Fahrverhalten und Beschleunigungskräfte ergänzen sich so glücklich, daß selbst der kritische Tester ihm das Prädikat „temperamentvoll“ zubilligen muß.
Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?
Bilder zu diesem Artikel

Eine Gerauchtwagenkaufberatung findet zeitlich zwischen den Neuwagentests einerseits und den Oldtimer-Berichten andereseits statt. Und damit in einer Phase des Autolebens, in welcher Kosten und Nutzen im Vordergrund stehen. Insofern eine interessante Ergänzung.
Ein P2 war zu diesem Zeitpunkt zwischen 3 und 6 Jahren alt. Empfohlen wird der Kauf eines Autos ab der Modellpflege im Herbst 1959, der „Funktionsschliff“ habe ab hier den höchsten Standard erreicht.
Es wird darauf hingewiesen, dass der 17m einer permanenten Detailverbesserung unterlag, die sich u.a. über den gesamten Produktionszeitraum in einer Reduzierung des relativ hohen Fahrzeuggewichts um 70 kg zeigt.
Solide Karosserie und sportliche Lenkung werden bescheinigt, aber „die Bremsen des 17m P2 waren und blieben schlecht“. Neben Fading wird auch auch die Neigung zum Bremsenrubbeln beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten reklamiert. Die Bremsen des Nachfolgers P3 werden ähnlich schlecht bewertet - „er hatte die Scheibenbremsen nötiger als jeder andere Wagen“. Die Scheibenbremsen vorn gab es beim TS ab April 1962 als Sonderausstattung, ab August 1963 waren sie bei allen P3 Modellen serienmässig verbaut.
Der raue Motorlauf des Ford-Reihenvierzylinders wird oft beschrieben, jedoch gab es wohl deutliche Schwankungen und von daher wird empfohlen, eher einen P2 mit ruhigerem Motorlauf zu finden und zu kaufen. Die Rauheit wird wesentlich auf die Verwendung der hohlgegossenen Kurbelwelle zurückgeführt.
Ausdrücklich wird der Kauf eines Fahrzeugs mit 3-Ganggetriebe nahegelegt. Das 4-Ganggetriebe wird als schwer schaltbar und hakelig beschrieben. Auf die Kombination 3-Ganggetriebe + Saxomat + Overdrive wird als interessante Rarität hingewiesen.
Das Fazit zum gebrauchten P2 ist, dass „nichts an dem Wagen eigentlich hervorragend ist, aber guter Durchschnitt ist viel wert.“ Generell wird als bester Kauf ein Modell ab Herbst 1959 mit maximal 60.000 km Laufleistung empfohlen. Die Ausstattungsvariante spielt keine Rolle. Wegen der schlechte Weiterverkaufschancen (!) solle der gebraucht erstandene P2 drei Jahre bis ca. 105.000 km gefahren werden, um so das Optimum aus Wertverlust und noch nicht fälligen verschleissbedingten Großreparaturen zu treffen. Wer mehr als 15.000 km pro Jahr fährt, möge wegen der besseren Werthaltigkeit zum 1,5 Liter P3 oder einem Rekord 1,5 Liter greifen.









































































































































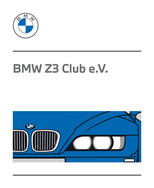



Kommentare