Mercedes-Benz 130 - mit dem Motor hinten der Zeit zu weit voraus
Artikel verschenken
Jetzt abonnieren und Artikel verschenken
Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.
PDF nicht verfügbar
Technischer Fehler
Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.
PDF drucken
«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Zu Merkliste hinzufügen
Login
Premium-Abo kaufen
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Der Einsteigertarif
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!
Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.



























































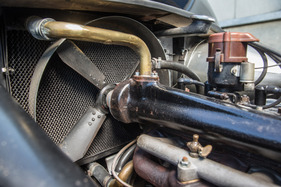





































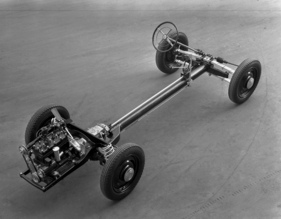

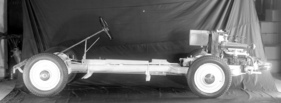
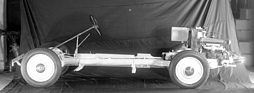
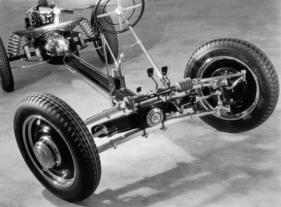









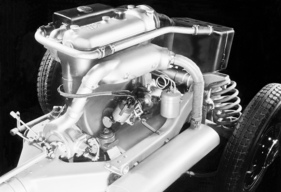





















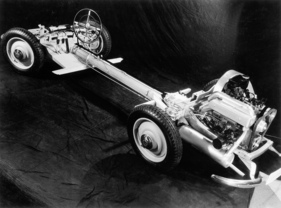





Sie haben nur
3 von 71
Bilder in hoher Auflösung gesehen
Information
Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.
Zusammenfassung
Mit dem kompakten Mercedes-Benz 130 wollte der Stuttgarter Hersteller einen Personenwagen für neue Kundengruppen bauen. Mit dem wassergekühlten Heckmotor betrat man Neuland, mit dem ungewöhnlichen Äusseren differenzierte man sich von der Konkurrenz. Die Kundschaft aber wollte nicht so recht zugreifen, was sich auch nicht änderte, als man den 130 zum 170 H weiterverfeinerte. Dieser Fahrzeugbericht portraitiert einen Mercedes-Benz 130 von 1935, rollt dessen Entwicklungsgeschichte auf und zeigt die verwandten Typen 150 und 170 H zusammen mit dem 130 auf historischem Bild- und Prospektmaterial.
Dieser Artikel enthält folgende Kapitel
- Pioniertat
- Zukunftsweisend
- Luxus fürs Volk?
- Kritik am Fahrverhalten
- Unterwegs
- Der noch innovativere Zwischenschritt
- Der ausgefeilte Schluss
- Weitere Informationen
Geschätzte Lesedauer: 6min
Leseprobe (Beginn des Artikels)
In den Dreissigerjahren waren Automobile nur für wenige erschwinglich und auch die Palette des Herstellers Mercedes-Benz richtete sich mit Wagen wie dem 500 K oder 290 vor allem an die Oberschicht. Die Ingenieure Hans Nibel und Max Wagner aber sannen nach neuen Lösungsansätzen, um auch weniger vermögenden Leuten den Zugang zum Auto zu ermöglichen. Und so entstand der Typ 130. Die Autos der Zwanziger- und Dreissigerjahre waren im Grossen und Ganzen immer nach ähnlichen Ideen konstruiert worden, der Motor sass vorne hinter einem mächtigen Kühler, der Antrieb erfolgte über die Hinterachse, für die Passagiere stand zwischen dem meist grossen Motor und dem abrupten Heckabschluss vergleichsweise wenig Platz zur Verfügung, der Luftwiderstand spielte kaum eine Rolle.
Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?
Premium-Artikel freischalten
Bilder zu diesem Artikel

Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.
vor einiger Zeit übermittelte ich Ihnen u.a auch historische Bilder die den 130H im April 1934 auf dem Nürburgring zeigen z.B. mit Alfred Neubauer bzw. auch mit einer Dame am Steuer direkt vor dem Zeitnehmerhaus.
Ob der 130H seinerzeit wohl auf dem Nürburgring "getestet" wurde?
Herzliche Grüße
Karl Heinz
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Das Anmelden dauert wenige Sekunden.
Empfohlene Artikel / Verweise
Mehr lesen zum Thema
Aus dem Zeitschriftenarchiv
Aktuelle Fahrzeug-Inserate
Aktuelle Marktpreise (Auswahl)
Spezialisten (Auswahl)
Spezialist
Sirnach, Schweiz
+41 71 969 47 69
Spezialisiert auf Audi, BMW, ...




Spezialist
Ismaning, Deutschland
+498996055191
Spezialisiert auf Mercedes Benz, Ford (USA), ...
Spezialist
Amsterdam, Niederlande
Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...




Spezialist
St. Margrethen, Schweiz
+41 (0)71 450 01 11
Spezialisiert auf Mercedes Benz, VW, ...




Spezialist
Au, Schweiz
+41 71 280 22 22
Spezialisiert auf Volvo, Saab, ...
Spezialist
Muhen, Schweiz
+41 79 332 81 91
Spezialisiert auf AC, Adler, ...




Spezialist
Zug, Schweiz
+41 (0) 43 813 56 56
Spezialisiert auf Rolls-Royce, Bentley, ...




Spezialist
Eberdingen-Hochdorf, Deutschland
+49 7042 270990
Spezialisiert auf Mercedes-Benz, Porsche, ...




Spezialist
Bern, Schweiz
+41 31 326 27 90
Spezialisiert auf Aston Martin, Alfa Romeo, ...
Spezialist
Safenwil, Schweiz
+41 62 788 79 20
Spezialisiert auf Jaguar, Toyota, ...




Spezialist
Noord-Brabant, Niederlande
0031 416 751 393
Spezialisiert auf MG, Triumph, ...
Spezialist
Wendelstein, Deutschland
+49 912926244
Spezialisiert auf Porsche, BMW, ...






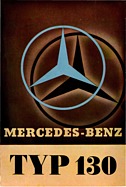

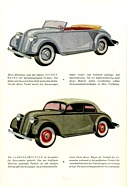
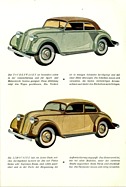





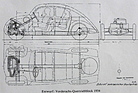


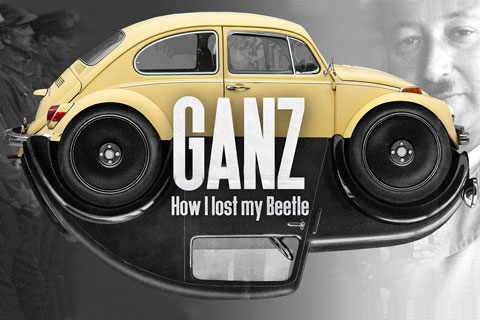


































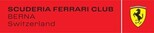


Kommentare