Wie fängt man einen Text über die exzellente Sammlung Grundmann an? Vielleicht zunächst mit der Feststellung, dass es sich nicht um ein Museum handelt, denn feste Öffnungszeiten und Eintrittspreise gibt es nicht. Und eigentlich ist sie auch nicht nur eine reine Volkswagensammlung, schon weil sie durch eine einzigartige Kollektion von Autos der einstigen Berliner Firma Rometsch ergänzt wird. Also eher eine aus zwei Teilen bestehende Sammlung, deren gemeinsamer Nenner frühe Volkswagen sind …
Über 80 Zeitzeugen laden zum Verweilen ein
Es ist erstaunlich, welche Fundstücke Traugott Grundmann und sein Sohn Christian in den letzten Jahrzehnten zusammengetragen und selbst restauriert haben. Sorgsam zeitgenössisch dekoriert, haben die über 80 Autos in mehreren Hallen in einer kleinen Stadt des Weserberglandes eine neue Heimat gefunden. Und wer - wie der Verfasser - das Glück hat, von Traugott Grundmann persönlich durch die Sammlung geführt zu werden, taucht mit ihm tief in die deutsche Automobilhistorie und die Seele des Volkswagens ein. Und nicht zuletzt sind es die Details der äußerst seltenen Exponate, die faszinieren. Dem Sammlungsgründer ist daher zuzustimmen, wenn er beiläufig anmerkt, dass man hier gut und gerne einen ganzen Tag zubringen könne…
Zwischen Beeskow und Lawrence
Der Rundgang startet mit der Firma Rometsch, der die "Grundmänner" eine eigene Halle gewidmet haben. Sie beherbergt die weltgrößte Sammlung dieser seltenen Autos. Dazu einige Fakten: Friedrich Rometsch, der zuvor bei der renommierten Firma Erdmann & Rossi tätig gewesen war, gründete im Jahr 1924 seine eigene Karosseriebaufirma, die bis zur Jahrtausendwende aktiv war. In dieser Zeit wurden außer Karosseriereparaturen für die unterschiedlichsten Auftraggeber Sonderaufbauten gefertigt und nebenbei schon 1942 erstmals in Deutschland elektrische Fensterheber konstruiert. Berühmt wurde Rometsch in den 1950er Jahren als Hersteller sportlich-eleganter Autos auf Käferfahrgestellen, nämlich mit den Modellen Beeskow und Lawrence. Johannes Beeskow, nach heutigem Sprachgebrauch der Designer des nach ihm benannten Modells, war wie Rometsch bei Erdmann & Rossi beschäftigt gewesen.
Grundmann sen. hatte zu Rometsch und Beeskow guten persönlichen Kontakt und kann daher aus erster Hand berichten, wie es zu deren Zusammenarbeit kam, doch das dürfte hier zu weit führen. Jedenfalls fanden die formschönen Autos auf der Basis des Käfers in den 1950er Jahren sowohl als Coupé als auch als Cabrio bei der Prominenz, auch in den USA, Anklang. Prominente Besitzer eines Rometsch Beeskow waren Viktor de Kowa, Audrey Hepburn, Gregory Peck und Aenne Burda. Die Autos der beiden Letztgenannten befinden sich in der Grundmann-Sammlung. Und im ARD-Zweiteiler "Aenne Burda: Die Wirtschaftswunderfrau" (mit Katharina Wackernagel in der Hauptrolle) waren Fahrzeuge aus der Grundmann-Kollektion zu sehen. Anfangs bezog Rometsch die Käferfahrgestelle für seine Autos noch beim lokalen Volkswagenhändler. Doch mit wachsendem Erfolg des Beeskow missfiel dies dem Werk, schon wegen der Konkurrenz mit dem Eigenprodukt VW Karmann-Ghia, weshalb Wolfsburg einen Lieferboykott gegen Rometsch verhängte. Der damalige VW-Chef Nordhoff soll konstatiert haben, "Volkswagen ist eine Automobilfabrik und keine Chassisfabrik".
Für Rometsch war dies aber kein ernsthaftes Problem, da er sich nun Neufahrzeuge über Dritte besorgte oder seine Kunden bei ihm gleich ihren neuen Käfer zur Weiterverarbeitung abgaben. So hatte Rometsch die benötigten Fahrgestelle, doch die Karosserien waren übrig. Dazu zeigt Grundmann sen. ein von der Firma Rometsch aufgegebenes Zeitungsinserat mit dem Text: "Einige fabrikneue VW-Serien-Export-Karosserien Mod. 54, letzte Ausführung, preisgünstig abzugeben". Dem Zeitgeist entsprechend, und wohl auch im Hinblick auf die US-Kundschaft, präsentierte Rometsch ab 1957 einen "amerikanisierten" Nachfolger des Beeskow, nämlich das Modell Lawrence mit Panoramascheibe. Doch 1961 endete die Automobilproduktion abrupt. Nicht aber mangels Nachfrage, sondern durch den Bau der Mauer. Der überwiegende Teil der Rometsch-Karosseriebauer stammte nämlich aus dem Ost-Berlin und stand somit plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Etwas ungewohnt mutet eine weitere frühe Kreation von Rometsch an: Die viertürige(!) Version des Käfers von 1952 auf verlängertem Chassis, welche in Berlin als Taxi eingesetzt wurde. Es ist das einzige in Europa erhaltene Exemplar.
In den Jahren 1951 bis 1953 entstanden bei Rometsch rund 30 solcher Taxis, später wurden bei Messerschmitt in Frankfurt noch weitere gebaut. Nette Anekdote am Rande: Das Dach des ausgestellten Käfertaxis zieren zwei Lampen, auf deren gelben Streuscheiben "Taxi" zu lesen ist. "Die Berliner nannten die Hungerlichter" weiß Grundmann zu berichten, denn: "Waren die Lichter eingeschaltet, stand das Taxi und der Fahrer konnte nichts verdienen". Automobilhistorisch bemerkenswert ist die Entstehungsgeschichte eines auf Rometsch zurückgehenden markanten Stilmerkmals, nämlich der Lanzette oder "Radpfeife" oberhalb der vorderen Radausschnitte. Diese gab es nämlich zuerst beim Beeskow und erst später bei den Mercedes SL-Typen der 1950er Jahre. "Sie verdanken ihre Entstehung allein dem Umstand, dass der TÜV nicht akzeptierte, dass die Räder aus der Karosserie ragten" klärt Grundmann auf. Und er berichtet auch, dass die Firma Rometsch unter strengster Diskretion Umbauten für den damaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker fertigte, so zum Beispiel dessen Jagdwagen. Die "Rometsch-Halle" ist ansprechend mit einschlägigem Originalmaterial ausgestattet. Hierzu zählen der Schreibtisch des Firmenchefs und das originale Zeichenbrett mit Skizzen des Lawrence. Die Sammlung Grundmann verfügt ferner über die originale Werkstatteinrichtung von Rometsch sowie die Formen, auf denen die Karosseriebleche einst gedengelt wurden.
«zuverlässiger Maserati Servicepartner seit 1983»
67433 Neustadt, Deutschland
- Wartung, Reparatur & Pflege
- Fahrwerk
- Reinigung & Pflege
- Cabrioverdecke
- Tuning
- Allgemeine Wartung
- und weitere ...
Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, und weitere
Concours-Gewinner, Unikate und Prototypen
Alle ausgestellten Wagen von Rometsch sind entweder im exzellenten Originalzustand oder von den "Grundmännern" perfekt restauriert worden. So wundert es den Besucher nicht wirklich, dass das Beeskow Coupé von 1951 im letzten Jahr beim Concours d´Elegance in Amelia Island, Florida in seiner Klasse den ersten Preis gewonnen hat. In dieser Liga dürfte auch ein weiteres seltenes Exponat spielen, welches in einer anderen Abteilung ausgestellt ist: der Denzel 1300 von 1957, welcher sich in der Nachbarschaft einer Phalanx von Porsche Vierzylinder-Modellen befindet. Der mit einer knapp sitzenden Alukarosserie versehene Zweisitzer ist mit seinen 52 PS seinerzeit ein echter Sportwagen gewesen. Er ist perfekt proportioniert und erinnert den Verfasser etwas an den Porsche 550 Spyder. Manche Leser werden mit dem Namen Denzel vielleicht eher den BMW 700 assoziieren, denn der Österreicher hatte in Zusammenarbeit mit Michelotti jenen Kleinwagen initiiert, welcher die Zeit bis zum Erscheinen der "Neuen Klasse" von BMW rettend überbrückte. Das Spektrum der soeben erwähnten Porsche beginnt bei einem makellosen 356 Pre A -Coupé mit geteilter Frontscheibe von 1950, prämiert bei den Schloss Dyck Masterpieces 2019.
Überhaupt kommen die Liebhaber früher Porsche in dieser Abteilung auf ihre Kosten, egal ob es ein Knickscheiben-356, Speedster, Carrera 2 oder 912 ist. Beim Rundgang weist Traugott Grundmann eher beiläufig darauf hin, dass es ich oft um Fahrzeuge aus Erstbesitz mit matching numbers bzw. wenig Laufleistung handelt. In diesem Ambiente befinden sich auch Eigenkonstruktionen aus der früheren DDR, so etwa der Sportwagen Lorenz 1,1 Liter von 1951, welcher vor einigen Jahren in Sachsen gefunden wurde. Das Fahrzeug entstand auf der Basis eines VW-Kübels aus dem 2. Weltkrieg. Es zeugt von hohem handwerklichen Können und Improvisationstalent und steht auf Rädern von Opel, die durch Bohrungen gewichtsoptimiert wurden. Dass dieses und andere Fahrzeuge der Sammlung überhaupt noch existieren, ist Grundmann jun. zu verdanken, der einige Autos in der Zeit direkt nach der Wende in den neuen Bundesländern aufgespürt hat und erwerben konnte.
Nun aber zum Wesentlichen
Eine weitere geräumige Halle enthält eigentlich alles Wesentliche zur Geschichte des VW Käfers. Wer hier automobile Grundlagenforschung betreiben will, wird fündig. Egal, ob Käfer, Bulli T1, Kübel- oder Schwimmwagen- jedes Exponat hat eine Geschichte zu erzählen. Am bekanntesten ist wohl er bei Porsche handgefertigte Prototyp Nr. 6 des Brezelkäfers von 1938, den die "Grundmänner" in Litauen ("in der Nähe des früheren Königsberg") als Wrack ausfindig machten und erwarben. Wer den heutigen Zustand mit den Bildern vom Fundzustand des Autos abgleicht, kann ermessen, wie viel Arbeit und Sorgfalt in den Wiederaufbau geflossen sein müssen. Dies wurde mit dem Gewinn des Goldenen Klassik Lenkrads 2012 einer bekannten Oldtimerzeitschrift für die "Restaurierung des Jahres" belohnt. Auch der Grundstein der Sammlung hat hier einen Ehrenplatz gefunden: Es ist ein Käfercabrio von 1957, welches Traugott Grundmann während seiner Zeit als Pilotenausbilder in den USA entdeckte und restaurierte. Und sodann - nach einer Tour von 6000 km quer durch die USA - mitbrachte. In dieser Abteilung steht ein Prototyp des Kübelwagens neben einem Käfer, der einst auf den NS-Ideologen Alfred Rosenberg zugelassen war, und gegenüber ist ein Volkswagenderivat zu sehen, welches als Schleppfahrzeug für Jagdflugzeuge eingesetzt wurde. Auch ein erstaunlich modern wirkender Wohnwagen, vor den der KdF-Wagen gespannt werden sollte, findet sich.
Ferner sind diverse Volkswagen zu sehen, die nach Kriegsende für das britische Militär zusammengebaut wurden - darunter einer speziell für das weibliche Militärpersonal. Und immer wieder entdeckt man interessante Details. So fällt etwa auf, dass einem Käfer der ganz frühen Nachkriegsproduktion aus Materialmangel die Scheinwerfer des Kübelwagens eingesetzt wurden. Mehrere Varianten eines offenen Käfer-Polizeiwagens der Nachkriegszeit finden sich ebenfalls. Und auch für Freunde des T1 gibt es viel zu entdecken: Etwa den älteste VW-Kombi der Welt von 1950, einen Sambabus von 1954 oder der älteste als Radiostation ausgebaute Bulli. Natürlich fehlt auch eine Reihe von Karmann-Ghias nicht. Neben mehreren des Typs 14 auch ein Prototyp des Typ 34 Cabrios, übrigens das letzte Projekt, an dem Johannes Beeskow beteiligt war, der seine berufliche Laufbahn als technischer Leiter bei Karmann beendete. Von diesem Auto waren bereits Verkaufsprospekte gedruckt. "Doch es ging nie in Serie, weil GM wegen der Ähnlichkeit mit dem Chevrolet Corvair Cabrio mit rechtlichen Schritten drohte" kommentiert der Sammler Grundmann.
Die Ausstellung umfasst auch ganz sportliche Volkswagen, neben einem Vertreter der Formel V etwa einen Käfer, der von 1973 bis 2014 ausschließlich als Rennfahrzeug unterwegs war. Natürlich darf in einer derartigen Sammlung auch kein Hebmüller-Cabrio fehlen. Ausgestellt ist das älteste noch erhaltene Exemplar Baujahr 1949 in schwarz-rot, die Nr. 5 von einst 696 gebauten Cabrios. Davor steht ein weiterer Leckerbissen, ein Cabriolet der Stuttgarter Firma Dannenhauer & Stauss von 1956. Das formschöne, von vorne etwas an den Porsche 356 erinnernde Auto ist eines von nur knapp 100 gefertigten Fahrzeugen, natürlich auf Käferbasis. Nach einem kurzen Blick auf einen Käfer 1303, der einst Götz George ("Horst Schimanski") gehörte, stehen wir am Ende des Rundgangs plötzlich in einem kleinen amerikanischen Diner und werden von Herbie, dem "tollen Käfer" mit der Nr. 53 und dem kalifornischen Nummernschild OFP 857, bekannt aus diversen Disney- Produktionen, verabschiedet. Natürlich ist auch das eines der 26 Originalfahrzeuge, die für Filmaufnahmen benutzt wurden.
Zeit, sich ebenfalls zu verabschieden und bei Traugott Grundmann für die lehrreiche Führung durch die einmalige Sammlung zu bedanken. Hier würde man sich tatsächlich gerne einmal einen ganzen Tag aufhalten...




















































































































































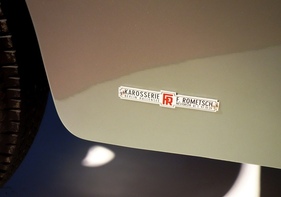










































































Kommentare