Renault Domaine – Die Freizeit-Fregatte
Artikel verschenken
Jetzt abonnieren und Artikel verschenken
Machen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden eine Freude: Mit einem Abo können Sie unbegrenzt Artikel verschenken.
PDF nicht verfügbar
Technischer Fehler
Das PDF konnte aus technischen Gründen nicht erzeugt werden. Bitte kontaktieren Sie den Kundensupport via Kontaktformular.
PDF drucken
«PDFs runterladen und drucken» ist exklusiv für unsere Premium-PRO-Mitglieder vorbehalten.
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Zu Merkliste hinzufügen
Login
Premium-Abo kaufen
Premium Light
EUR/CHF
4.70 / Monat
Der Einsteigertarif
Premium PRO
EUR/CHF
105.00 / Jahr
Für wahre Oldtimer-Fans
Premium PRO 2 Jahre
EUR/CHF175.00 (-16%)
Stark in Preis/Leistung
Weitere Premium-Angebote inkl. Kombi-Angebote finden Sie im Online-Shop.
Bereits Premium-Mitglied? Jetzt einloggen.
Sie lieben grosse Fotos? Wir auch!
Und wir wollen sie auch gerne weiterhin mit Ihnen teilen: Einfach hier kostenlos registrieren.





















































































































Sie haben nur
1 von 59
Bilder in hoher Auflösung gesehen
Information
Um mehr Bilder in hoher Auflösung zu sehen, müssen Sie sich einloggen.
Zusammenfassung
Der Renault Frégate hatte es nicht leicht. Als er der Konkurrenz noch voraus war, ruinierten Kinderkrankheiten seinen Ruf. Als er dann endlich ausgereift war, galt er schon wieder als veraltet. Dem Kombi namens Domaine erging es da nicht anders: Er war schick und geräumig – aber eben nicht schick oder geräumig genug. Dieser Artikel erzählt die Geschichte des ersten grossen Renault nach dem Krieg mit viel historischem Bildmaterial sowie Verkaufsliteratur und zeigt einen Domaine von 1957 in Farbe.
Dieser Artikel enthält folgende Kapitel
- Fortschrittlich verfrüht
- Die Frégate für den Gutsherrn
- Automatisiert ans Ende
- Hübschgemacht für die Gegenwart
Geschätzte Lesedauer: 9min
Leseprobe (Beginn des Artikels)
Als der Renault Domaine Ende 1956 erschien, war sein Schöpfer schon tot. Pierre Lefaucheux, seit der Verstaatlichung im Januar 1945 Direktor der Renault-Werke, war am 11. Februar 1955 mit seinem Renault Frégate verunglückt – jener Mittelklasse-Limousine, deren Fürsprecher und Wegbereiter er Zeit seines Amtes gewesen war und deren Ableger mit kombinationsstarkem Hinterteil erst mit sechs Jahren Verspätung erschien. Obgleich Vorantreiber des Projektes, war Lefaucheux keineswegs der Initiator. Bereits 1943 war auf Basis des Primaquatre ein Prototyp für einen neuen "Grossen Renault" als Konkurrent für den Citroën 11 CV entstanden, den aber ironischerweise die Befreiung Frankreichs verhindert hatte, da das Werk bei einem alliierten Luftangriff zerstört worden war. Der Tod von Louis Renault im Oktober 1944 besiegelte dann das vorläufige Ende.
Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?
Premium-Artikel freischalten
Bilder zu diesem Artikel

Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.


Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Mit einem Gratis-Login auf Zwischengas können Sie nicht nur mitreden, sondern Sie profitieren sofort von etlichen Vorteilen.
Information
Kostenlos anmelden und mitreden!
Das Anmelden dauert wenige Sekunden.
Empfohlene Artikel / Verweise
Markenseiten
Aus dem Zeitschriftenarchiv
Aktuelle Fahrzeug-Inserate
Aktuelle Marktpreise (Auswahl)
Spezialisten (Auswahl)
Spezialist
Sirnach, Schweiz
+41 71 969 47 69
Spezialisiert auf Audi, BMW, ...




Spezialist
Muhen, Schweiz
+41 79 332 81 91
Spezialisiert auf AC, Adler, ...




Spezialist
Amsterdam, Niederlande
Spezialisiert auf Ford, Jaguar, ...











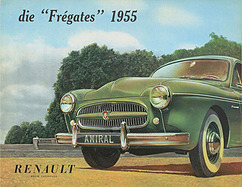
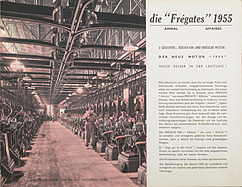
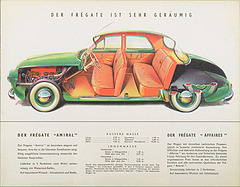
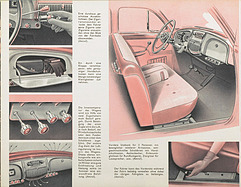
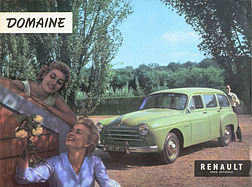
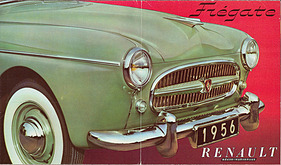









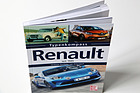







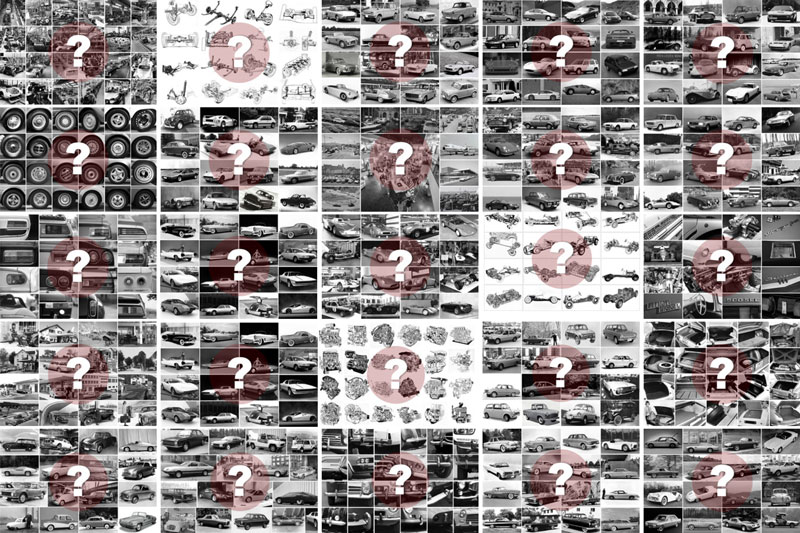













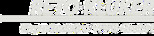






Kommentare