Die Rennpappe (alias Trabant P601)
Zusammenfassung
Zum Rennfahren war das DDR-Auto Trabant zwar nicht entwickelt worden, doch entwickelte er auch auf den Rennstrecken und Rallyepfaden ungeahnte Talente, nicht zuletzt dank herzhaften Gewichtserleichterungen und zusätzlichen PS aus dem Zweitakter. Dieser Fahrzeugbericht erzählt die Geschichte des Trabant und seiner Erfolge im Rennsport, illustriert mit Bildern eines historischen Rennwagens.
Dieser Artikel enthält folgende Kapitel
- Am Parteitag präsentiert
- Wie entstand die "Pappe"?
- Rennsport im Osten
- Die Oma als Retterin
- Werksseitig im internationalen Rallye-Sport
- Schwarz und doch farbig
- Technische Daten P601
Geschätzte Lesedauer: 6min
Leseprobe (Beginn des Artikels)
Als die Strassen des Westens von den Kleinwagen Goggomobil, BMW Isetta und dem Zündapp Janus befahren wurden, entwickelte der Osten den Trabant. "Die Bezeichnung Trabant sollte Symbol eines zuverlässigen Begleiters seiner Nutzer sein", so die Leitung des volkseigenen Betriebs in Zwickau. Die spezielle Bauweise der selbsttragenden Karosserie mit Metallgerippe und Kunststoffbeplankung wurde später auch von Renault beim Espace und beim Smart übernommen und modifiziert. Zunächst gab es auch kaum Wartezeiten, doch in der Regierungszeit Honeckers 1971 änderte sich die Wirtschaftspolitik und die Weiterentwicklung von Autos kam praktisch zum Stillstand. Die Produktionszahlen blieben stabil, der Bedarf stieg, damit auch die Wartezeiten. Dieser Stillstand in allen Branchen führte schlussendlich auch zum Untergang des Staates.
Diesen Artikel kostenlos weiterlesen?
Bilder zu diesem Artikel




























































































































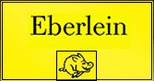








Kommentare